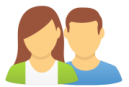Hallo zusammen,
meine Fragen richten sich an alle die VWL01 schon hinter sich haben oder wie ich mitten in der Klausurvorbereitung stecken.
Ich schreibe am Freitag die Klausur. Während der Vorbereitung bin ich über ein paar alte Klausurfragen gestolpert, die ich nicht beantworten kann. Ich hoffe dass Ihr mir weiter helfen bzw. mir ein paar Denkanstöße geben könnt.
Es geht um folgende Fragen:
Strommarktaufgabe: Wie kann bei einem Strom-Unternehmen ein natürliches Monopol entstehen und welche Auswirkungen hat dies auf a) die Stromabnehmer b) die anderen Stromanbieter?
Tsunamiaufgabe: Diskutieren Sie Möglichkeiten wie man das System (Tsunami-Frühwarnsystem) auf Kosten der Nutznießer erhalten kann und welche Probleme dabei praktisch auftreten können?
Agrarsubventionsaufgabe: Wie kann der Staat mit Subventionen Mindespreise garantieren?
Vielen vielen Dank vorab
Sabrina
VWL01 Hilfe/ Denkanstöße für die Klausurvorbereitung
Hallo Sabina.
Ich stecke auch gerande in den Vorbereitungen VWL01 und schreibe diese Woche am 18.
Zu deinen Fragen
1 Frage
Von einem natürlichen Monopol (oder auch Effizienzmonopol) spricht man, wenn der Grund für die Monopolstellung eines Anbieters darin liegt, dass er die am Markt nachgefragte Menge kostengünstiger herstellen kann als zwei oder mehrere Anbieter. Das Monopol ist in diesem Fall die effizienteste Marktform.
Dies ist der Fall, wenn eine subadditive Kostenfunktion im relevanten Mengenbereich der Nachfrage vorliegt. Eine subadditive Kostenfunktion bedeutet, dass die Summe der Produktionskosten bei Produktion in mehreren Betrieben höher ist als bei konzentrierter Produktion des Gutes in einem Monopolbetrieb. Eine solche Subadditivität der Kostenfunktion kann darauf zurückgeführt werden, dass die Stückkosten mit steigender Ausbringungsmenge stetig abnehmen, so dass das Unternehmen mit der größten Produktionsmenge am billigsten anbieten kann. Sinkenden Stückkosten treten beispielsweise auf, wenn die Produktion mit hohen Fixkosten verbunden ist, weil z.B. eine hochwertige Maschine benötigt wird.
Der Strommarkt neigt zum natürlichen Monopol, weil für die Gewinnung von Strom enorm hohe Anschaffungs- und Fixkosten entstehen. Kann man diese Kosten aber bewältigen, so hat man den Vorteil, dass die Kosten für die einzelnen Stromeinheiten nur noch relativ gering sind. Je höher die Ausbringungsmenge nun ist, desto mehr sorgt Fixkostendegression dafür, dass die Kosten je Einheit sinken. Dadurch sinken also auch Grenzkosten und gesamte Durchschnittskosten. Da es für das Gut Strom viele Nachfrager gibt und kaum Substitutionsprodukte, kann das Unternehmen auch viele Einheiten seines Gutes absetzen. Andere Anbieter haben es in dieser Situation sehr schwer. Sie können nur bei ähnlich Absatzzahlen mithalten, müssten dafür aber zunächst sehr viel investieren, um mit ihren Produktionsanlagen gleiche Mengen produzieren zu können. Da es nicht möglich ist, die Investitionskosten durch einen hohen Einführungspreis zu decken, ist ein Markteinstieg in dieser Branche kaum möglich. Deshalb neigt der Strommarkt tendenziell zum natürlichen Monopol.
Frage 2
Im Tsunamifall sollte man ermitteln, wer in welchem Umfang von dem Warnsystem profitiert, beispielsweise anhand von Analysen, die Auskunft darüber geben, wer wie stark gefährdet ist und das Warnsystem deshalb besonders benötigt. Wenn diese Aufteilung geklärt ist, dann werden die entsprechenden Kosten anteilig aufgeteilt. Die einzelnen Länder könnten die hohen Kosten dann beispielsweise durch die Einführung einer Steuer in ihrem Land abdecken. So ist gewährleistet, dass sich jeder an den Kosten beteiligt und das Gleichgewicht von Kosten und Nutzen wieder hergestellt wird.
Probleme wird es an dieser Stelle vielleicht geben, weil sich die einzelnen Länder zunächst einigen müssen, wer nun wirklich wie stark von dem System profitiert. In einem solchen Fall ist es ja schwierig, eine genaue Zuteilung des Nutzens zu machen.
Ich hoffe ich konnte dir ein bischen helfen.
Gruß Jens
Ich stecke auch gerande in den Vorbereitungen VWL01 und schreibe diese Woche am 18.
Zu deinen Fragen
1 Frage
Von einem natürlichen Monopol (oder auch Effizienzmonopol) spricht man, wenn der Grund für die Monopolstellung eines Anbieters darin liegt, dass er die am Markt nachgefragte Menge kostengünstiger herstellen kann als zwei oder mehrere Anbieter. Das Monopol ist in diesem Fall die effizienteste Marktform.
Dies ist der Fall, wenn eine subadditive Kostenfunktion im relevanten Mengenbereich der Nachfrage vorliegt. Eine subadditive Kostenfunktion bedeutet, dass die Summe der Produktionskosten bei Produktion in mehreren Betrieben höher ist als bei konzentrierter Produktion des Gutes in einem Monopolbetrieb. Eine solche Subadditivität der Kostenfunktion kann darauf zurückgeführt werden, dass die Stückkosten mit steigender Ausbringungsmenge stetig abnehmen, so dass das Unternehmen mit der größten Produktionsmenge am billigsten anbieten kann. Sinkenden Stückkosten treten beispielsweise auf, wenn die Produktion mit hohen Fixkosten verbunden ist, weil z.B. eine hochwertige Maschine benötigt wird.
Der Strommarkt neigt zum natürlichen Monopol, weil für die Gewinnung von Strom enorm hohe Anschaffungs- und Fixkosten entstehen. Kann man diese Kosten aber bewältigen, so hat man den Vorteil, dass die Kosten für die einzelnen Stromeinheiten nur noch relativ gering sind. Je höher die Ausbringungsmenge nun ist, desto mehr sorgt Fixkostendegression dafür, dass die Kosten je Einheit sinken. Dadurch sinken also auch Grenzkosten und gesamte Durchschnittskosten. Da es für das Gut Strom viele Nachfrager gibt und kaum Substitutionsprodukte, kann das Unternehmen auch viele Einheiten seines Gutes absetzen. Andere Anbieter haben es in dieser Situation sehr schwer. Sie können nur bei ähnlich Absatzzahlen mithalten, müssten dafür aber zunächst sehr viel investieren, um mit ihren Produktionsanlagen gleiche Mengen produzieren zu können. Da es nicht möglich ist, die Investitionskosten durch einen hohen Einführungspreis zu decken, ist ein Markteinstieg in dieser Branche kaum möglich. Deshalb neigt der Strommarkt tendenziell zum natürlichen Monopol.
Frage 2
Im Tsunamifall sollte man ermitteln, wer in welchem Umfang von dem Warnsystem profitiert, beispielsweise anhand von Analysen, die Auskunft darüber geben, wer wie stark gefährdet ist und das Warnsystem deshalb besonders benötigt. Wenn diese Aufteilung geklärt ist, dann werden die entsprechenden Kosten anteilig aufgeteilt. Die einzelnen Länder könnten die hohen Kosten dann beispielsweise durch die Einführung einer Steuer in ihrem Land abdecken. So ist gewährleistet, dass sich jeder an den Kosten beteiligt und das Gleichgewicht von Kosten und Nutzen wieder hergestellt wird.
Probleme wird es an dieser Stelle vielleicht geben, weil sich die einzelnen Länder zunächst einigen müssen, wer nun wirklich wie stark von dem System profitiert. In einem solchen Fall ist es ja schwierig, eine genaue Zuteilung des Nutzens zu machen.
Ich hoffe ich konnte dir ein bischen helfen.
Gruß Jens
Hey Jens,
super, vielen Dank, das hilft mir auf jeden Fall weiter.
Weißt du zufällig auch noch wie der Staat mit Subventionen Mindestpreise garantieren kann? Ich habe die Mindestpreisgarantierung nur aufgrund von Anbaubeschränkungen in der Landwirtschaft gefunden.
Wo schreibst du am Freitag die Klausur, bist du auch in FFM?
Viele Grüße
Sabrina
super, vielen Dank, das hilft mir auf jeden Fall weiter.
Weißt du zufällig auch noch wie der Staat mit Subventionen Mindestpreise garantieren kann? Ich habe die Mindestpreisgarantierung nur aufgrund von Anbaubeschränkungen in der Landwirtschaft gefunden.
Wo schreibst du am Freitag die Klausur, bist du auch in FFM?
Viele Grüße
Sabrina
Hallo Sabrina.
Ja ich schreibe in FFM. Vorher bin ich noch im Seminar das wird wieder ein langer Tag.
Zu einer Frage habe ich folgendes gefunden:
Die Festsetzung des Mindestpreises macht zusätzliche staatliche Maßnahmen notwendig, weil die Anbieter in Folge des Angebotsüberschusses beim Mindestpreis einen Teil ihrer Produktion nicht absetzen können. Die Überschussproduktion würde auf den Schwarzmarkt drängen und zu einem niedrigeren als dem Mindestpreis gehandelt. Um dies zu vermeiden, könnte der Staat entweder Anbaubeschränkungen erlassen oder aber den Angebotsüberschuss zum Mindestpreis aufkaufen. . Der Staat kann – etwa im Fall landwirtschaftlicher Produkte – die überschüssigen Mengen aufkaufen, einlagern und vernichten oder auf dem Weltmarkt verkaufen.
Mehr habe ich auch nicht gefunden zu mindestens nicht in der Kombination Subventionen und Mindestpreise.
Gruß Jens
Ja ich schreibe in FFM. Vorher bin ich noch im Seminar das wird wieder ein langer Tag.
Zu einer Frage habe ich folgendes gefunden:
Die Festsetzung des Mindestpreises macht zusätzliche staatliche Maßnahmen notwendig, weil die Anbieter in Folge des Angebotsüberschusses beim Mindestpreis einen Teil ihrer Produktion nicht absetzen können. Die Überschussproduktion würde auf den Schwarzmarkt drängen und zu einem niedrigeren als dem Mindestpreis gehandelt. Um dies zu vermeiden, könnte der Staat entweder Anbaubeschränkungen erlassen oder aber den Angebotsüberschuss zum Mindestpreis aufkaufen. . Der Staat kann – etwa im Fall landwirtschaftlicher Produkte – die überschüssigen Mengen aufkaufen, einlagern und vernichten oder auf dem Weltmarkt verkaufen.
Mehr habe ich auch nicht gefunden zu mindestens nicht in der Kombination Subventionen und Mindestpreise.
Gruß Jens