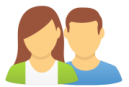Bevor die Vergessenheit einsetzt, anbei die Aufgaben der heutigen Klausur:
Detail(Lösungen sind den Lerneinheiten zu entnehmen):
- Wie wird ein Grundstück verkauft? Gibt es Formvorschriften?
- Welche Realsicherheiten gibt es?
- Was versteht man unter Naturalrestitution?
- Voraussetzungen für Haftung des Gschäftsherren nennen (§831)
- Muss Verbraucher nicht bestellte Ware zurückschicken?
- Welche Rechte hat ein Käufer bei Mängel?
- Wirksamkeit von Kaufverträgen unter Abwesenden und was passiert, wenn die Anname verspätet erfolgt?
- 3 Arten von Vermittlungsgeschäften nennen?
Bin mir nicht sicher, ob das alle waren.
Komplex (inkl. meiner Lösungs-Ansätze, zumindest hab ich die Fälle in der Klausur ähnlich ausformuliert...wie gehabt ohne Garantie auf Richtigkeit)
Fall 1:
Anwalt A kauft zur Privatnutzung einen Computer bei S. Die Festplatte ist nach 7 Monaten defekt. Der Anwalt ist sich nicht sicher, ob es ein Materialfehler ist, oder ob vielleicht seine minderjährigen Kinder den Schaden verursacht haben. Hinzu kommt, dass der Hersteller H der Festplatte eine Garantieerklärung abgegeben hat. "Alle Mängel innerhalb des ersten Jahres werden durch Reparatur behoben." Kann der Anwalt gegen S und H Ansprüche geltend machen?
--> Ausgangsfrage 1: Kann S Gewährleistungsansprüche gegenüber S geltend machen? Er könnte sich möglicherweise auf die in § 437 BGB genannten Rechte berufen. Dieser gibt Auskunft über die Rechte des Käufers bei Mängeln. Vorrangig müsste er dabei gem. § 439 Abs. 1 BGB i. V. m. §§ 437 Nr. 1, 434, 433 BGB Nacherfüllung verlangen. Als Voraussetzung muss zunächst ein wirksamer Kaufvertrag zwischen A und S zustande gekommen sein (vgl. § 433 BGB). Der Sachverhalt gibt keine Anzeichen dafür, dass dies hier nicht der Fall ist. Weiterhin müsste ein Mangel gem. § 434 BGB gegeben sein. Dies ist zu bejahen (vgl. § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB). Gem. § 434 Abs. 1 S. 1 BGB liegt ein Sachmangel nur vor, wenn dieser schon bei Gefahrübergang vorlag. Davon kann hier keine Rede sein, da die Festplatte erst 7 Monate nach dem Kauf defekt ist. Die Beweislast liegt grundsätzlich nach Abnahme der Sache beim Käufer (vgl. § 363 BGB). Da es sich bei dem Kauf allerdings gem. § 474 BGB um einen Verbrauchsgüterkauf handelt – denn A nutzt den Computer zu Privatzwecken und ist daher gem. § 13 BGB Verbraucher, während S gem. § 14 BGB Unternehmer ist, da er in Ausübung seiner gewerblichen Tätigkeit handelt – gelten besondere Vorschriften. Die Beweislastumkehr greift hier jedoch nicht mehr (vgl. § 476 BGB), da diese lediglich in den ersten 6 Monaten nach Gefahrübergang besteht. Somit liegt die Beweislast also weiterhin bei A. Ergebnis: Wenn A beweisen kann, dass der Sachmangel bereits bei Gefahrübergang vorlag, könnte er von seinen Gewährleistungsansprüchen Gebrauch machen und z.B. Nacherfüllung, Rücktritt vom Vertrag, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz verlangen. Da er dies allerdings nicht beweisen können wird, kann A keine Ansprüche ggü. S geltend machen. Ausgangsfrage 2: Kann A Ansprüche gegenüber H geltend machen? Da sich die Pflicht zur Gewährleistung aus dem Kaufvertrag ergibt und dieser lediglich zwischen A und S geschlossen wurde, sind aus diesem keine Ansprüche ggü. dem Hersteller herzuleiten. Aufgrund der Erklärung des Herstellers könnte allerdings ein selbstständiger Garantievertrag gem. §§ 311 Abs. 1, 241 Abs. 1 BGB i.V.m. § 443 Abs. 1 BGB zustande gekommen sein. Hierzu müsste der Hersteller eine Garantieerklärung abgegeben haben, was vorliegend der Fall ist. A stehen hier also als Käufer die Rechte aus der Garantie des H zu, die da lauten, dass sämtliche Schäden innerhalb des ersten Jahres (7 Monate sind erst um) behoben werden. Dieser Anspruch besteht unabhängig von der Frage, wann der Mangel eingetreten ist, da H für die Mangelfreiheit eine Haltbarkeitsgarantie für die Dauer von 12 Monaten übernommen hat. Ergebnis: A kann zwar keine Gewährleistungsansprüche gem. § 437 BGB gegen H geltend machen, wohl aber die Rechte aus der Garantieerklärung des H (vgl. §§ 311 Abs. 1, 241 Abs. 1 BGB i.V.m. § 443 Abs. 1 BGB). Er kann also – wie in der Garantieerklärung abgegeben – von H fordern, dass dieser den Mangel der Festplatte durch Reparatur behebt.
Fall 2:
Jemand verkauft altes Bild von dem er nicht weiß, dass es ein Rembrand ist. Käufer hat das schon geahnt. Nachdem der Käufer erfährt dass es tatsächlich ein echter Rembrand ist (wovon er nichts geahnt hatte), will er Kaufvertrag anfechten und fordert Herausgabe des Bildes. Welche Rechte hat er, also welche Ansprüche hat der Verkäufer gegen den Käufer?
--> Ausgangsfrage: Kann der Verkäufer die Rückgabe des Bildes von dem Käufer verlangen? Als Anspruchsgrundlage könnte § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB in Betracht kommen. Danach besteht eine Verpflichtung zur Herausgabe des Erlangten, wenn jemand etwas ohne rechtlichen Grund durch die Leistung eines anderen auf dessen Kosten erlangt hat. Erlangt hat hier der Käufer das Eigentum an dem Bild. Dies müsste auch durch Leistung des Verkäufers geschehen sein. Eine Leistung i. S. d. § 812 Abs. 1 BGB ist jede bewusste und zielgerichtete Vermehrung fremden Vermögens. Die Übergabe des Bildes vom Verkäufer an den Käufer erfolgte, weil der Verkäufer damit eine Leistungspflicht aus dem Kaufvertrag erfüllen wollte (vgl. § 433 Abs.1 BGB), der zwischen Käufer und Verkäufer über das besagte Bild aufgrund von entsprechenden Willenserklärungen – Angebot und Annahme – zustande gekommen ist. Der Rechtsgrund für diese Leistung war also der Kaufvertrag mit dem Käufer. Dieser Kaufvertrag könnte allerdings durch Anfechtung des V nichtig sein. Dies folgt aus § 142 Abs. 1 BGB und setzt voraus, dass der Verkäufer zu Anfechtung berechtigt war. Es müsste ein Anfechtungsgrund gegeben sein. Dies könnte hier ein Eigenschaftsirrtum gem. § 119 Abs. 2 BGB. Das Anfechtungsrecht ist vorliegend auch nicht subsidiär ggü. dem Mängelgewährleistungsrecht, obwohl dies dem Grunde nach bei erfolgter Übergabe und dem Vorliegen eines auch einen Mangel begründenden Eigenschaftsirrtums der Fall ist. Denn der Käufer ist hier nicht schutzbedürftig. Dieser ahnte nämlich, dass der V einem Irrtum hinsichtlich der Eigenschaft des Bildes unterlag. Da der Verkäufer im Gegensatz zu dem Käufer nicht geahnt hat, dass das Bild ein echter Rembrand ist (Irrtum über eine wesentliche Eigenschaft des Kaufgegenstandes), kann er seine Willenserklärung gem. § 119 Abs. 2 BGB anfechten. Gem. § 143 Abs. 1 BGB erfolgt diese Anfechtung durch Erklärung ggü. dem Anfechtungsgegner. Es ist davon auszugehen, dass die gem. § 121 Abs. 1 BGB einzuhaltende Anfechtungsfrist gewahrt wurde. Der Kaufvertrag ist damit also von Anfang an nichtig, so dass die Leistung ohne rechtlichen Grund erfolgt ist. Der Käufer ist gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB verpflichtet, den ohne Rechtsgrund erlangten Vermögensvorteil herauszugeben, um welchen er durch die Leistung des Verkäufers bereichert ist Ergebnis: Der Verkäufer kann also die Rückgabe des Bildes von dem Käufer zu Recht verlangen.
Fall 3:
(ähnlich Fall rotes Buch) der vergessene Hydrant (12,5P) Hier war es aber ein nicht gesicherter Schacht. Der Geselle G vom Bauunternehmer U führt die Arbeiten aus. Er vergisst am Freitag den Schacht abzudecken. Als B, der Auftraggeber, am Freitag sich die Baustelle noch mal ansieht, stürzt er in den nicht gesicherten Schacht. Kann B von U Schadenersatz/Schmerzensgeld verlangen?
--> Ausgangsfrage: Kann der Auftraggeber B Schadensersatz/Schmerzensgeld von dem Bauunternehmer U verlangen? Als Anspruchsgrundlagen wegen Pflichtverletzung könnte § 280 Abs. 1 BGB in Betracht kommen. Demnach müsste ein Schuldverhältnis bestehen und es müsste eine Pflichtverletzung vorliegen, die der Schuldner zu vertreten hat. Ein Schuldverhältnis besteht hier in Form eines Werkvertrags zwischen B und U. Dieser begründet nicht nur die in §§ 631 Abs. 1, 633 Abs. 1 BGB aufgeführte Hauptleistungspflicht, die Baumaßnahmen ordnungsgemäß durchzuführen, sondern nach § 241 Abs. 2 BGB auch Nebenpflichten. Dazu gehört es, dafür zu sorgen, dass B auf der Zufahrt zu seinem Grundstück keinen Schaden an Körper, Gesundheit und Eigentum erleidet. Gegen diese Pflicht wurde hier verstoßen, da der Schacht auf der Baustelle offen und vollkommen ungesichert war. U hatte dies nach § 276 Abs. 1 BGB nicht zu vertreten, da er den Schacht ja nicht selbst ungesichert offen gelassen hat, sondern sein Geselle G. Ob U hierfür einzustehen hat, beurteilt sich nach § 278 BGB. Dort wird gefordert, dass für U eine Verbindlichkeit besteht (diese ist die erwähnte Nebenpflicht, also die Schutzpflicht für Körper, Gesundheit und Eigentum des B), dass U sich zu deren Erfüllung eines anderen bedient (trifft zu, da G als sein Geselle die Arbeiten durchführt und somit auch für ihn die erwähnte Nebenpflicht besteht) und dass der Erfüllungsgehilfe sich bei der Erfüllungstätigkeit schuldhaft verhalten hat. Auch die letzte Forderung trifft hier zu, da es fahrlässig ist, einen Schacht offen und vollkommen ungesichert auf einer Baustelle zu hinterlassen (vgl. § 276 Abs. 2 BGB). U hat also nach § 278 BGB das Verschulden des G wie eigenes Verschulden zu vertreten. Da B in den Schacht fällt und sich verletzt, handelt es sich hier um einen immateriellen Schaden, für den Schadensersatz in Geld verlangt werden kann (vgl. § 253 Abs. 2 BGB). Der zu ersetzende Schaden wird allerdings durch ein Mitverschulden des B bei der Entstehung des Schadens gem. § 254 Abs. 1 BGB gemindert. Ergebnis: B kann Schadensersatz von U gem. §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 i.V.m. § 249 Abs. 1 BGB verlangen (Schadensersatz bezieht sich hier auf die materiellen Schäden wie z.B. Arztkosten). Er kann über dies Schmerzensgeld gem. §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 i.V.m. § 253 Abs. 1, 2 BGB verlangen (Ersatz des immateriellen Schadens). Als Anspruchgrundlage hätte auch § 831 BGB in Betracht kommen können. Eine der Voraussetzungen dafür wäre allerdings, dass U sich nicht exkulpieren können darf (§ 831 Abs. 1 S. 2 BGB). Da U jedoch mit G einen qualifizierten MA für die Arbeit eingesetzt hat, liegt ein Verschulden bei der Auswahl nicht vor. Eine dauernde Überwachung seiner Arbeit war nicht erforderlich, eine immer mal wieder erfolgte Kontrolle war hier ausreichend. Da die Anforderungen der Gerichtspraxis an den Entlastungsbeweis nicht allzu hohe Anforderungen stellen, ist also anzunehmen, dass U sich exkulpieren kann und daher eine Ersatzpflicht des U nach § 831 BGB nicht besteht.
That´s it! Die andere Komplexaufgabe habe ich mir gar nicht erst angeguckt! Allen, die es noch vor sich haben, viel Erfolg.
Gruss,
Eazy
WIR02 06.02.2010 Pinneberg
-
Der_Andi78
- Forums-Scout

- Beiträge: 750
- Registriert: 29.07.07 17:59
Besten Dank für die Niederschrift ...