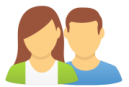Prüfungszulassung ohne Fachausbildung
Hallo allerseits,
vor allem Kandidaten aus den neuen EU-Ländern sind in Unkenntnis der Examensbestimmungen der deutschen Staatlichen Prüfungsämter (PA) für Übersetzer und Dolmetscher der Meinung, für die Meldung und Zulassung zur staatlichen Ü-Prüfung genüge der „Muttersprachlerstatus“ und ein längerer Aufenthalt in Deutschland.
Der oft vertretene Standpunkt: „Meine Muttersprache beherrsche ich ja, da brauche ich nicht mehr viel zu machen, ich brauche ja nur die Fremdsprache (Deutsch) zu lernen“, ist abwegig. Die zu Recht als anspruchsvoll geltende Ü-Prüfung kann nicht „nur mal so nebenbei“ mit unzureichenden fachsprachlichen, fachlichen und landeskundlichen Grundlagen absolviert werden.
Die staatlichen Prüfungsordnungen (PO) schreiben eine mehrsemestrige „einschlägige“ Fachausbildung im Fachbereich Übersetzen vor, die in Deutschland von privaten und staatlichen Ausbildungsträgern aber nur für relativ wenige Sprachen im Präsenz- bzw. im Fernunterricht (hier: AKAD Stuttgart; Englisch, Französisch, Spanisch) angeboten wird. Liegt keine Fachausbildung vor, kann die Eignung über eine mehrjährige Vollzeit-Übersetzertätigkeit durch qualifizierte Arbeitgeberzeugnisse nachgewiesen werden (Zulassung über Berufspraxis). An diese Nachweise werden strenge Anforderungen gestellt. Stehen für eine bestimmte Sprache in Deutschland keine Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfügung, könnte die Prüfungsvorbereitung hilfsweise eventuell durch einen überzeugenden (!), klar strukturierten Selbststudienplan in Anlehnung an die Prüfungsanforderungen nachgewiesen werden, wobei die Zulassung grundsätzlich im Ermessen des PA liegt. Welche Sprachen außer E, F, S, I von den PA der jeweiligen Bundesländer geprüft werden, kann der Sprachenliste unter www.oberschulamt-karlsruhe.de bzw. nach dessen organisatorischer Einbindung in das Regierungspräsidium Karlsruhe unter www.rp.baden-wuertemberg.de entnommen werden.
Nicht nur in seiner eigenen Muttersprache, sondern auch in der prüfungsrelevanten deutschen Sprache muss der Prüfungsbewerber über ein sprachliches Niveau verfügen, das weit über die Anforderungen der Hochschulreifeprüfung hinaus geht und nicht nur die Beherrschung der Terminologie mehrerer Fachbereiche, sondern vertiefte sachliche Kenntnisse in einem zu wählenden Fachgebiet im Deutschen und in der Fremdsprache sowie in der Übersetzungstechnik bedingt. Sein Lernziel ist daher immer mindestens ein doppeltes, nämlich seine Arbeitssprache und seine Muttersprache genauer kennenzulernen und mit viel Übung die Fähigkeit zu entwickeln, anspruchsvolle Gemein- und Fachtexte aus der einen in die andere Sprache zu übertragen und umgekehrt.
Der schlechteste Ratgeber für den „direkten Marsch in den Prüfungssaal“ ohne einschlägige Ausbildung bzw. Berufserfahrung ist erfahrungsgemäß die leider weit verbreitete Selbstüberschätzung der eigenen Kenntnisse. Bekannte und Freunde versichern dem Prüfungsbewerber schulterklopfend, so gute Sprachkenntnisse hätten sie schon lange nicht mehr gehört, während schriftliche Anfragen der gleichen Personen in den Übersetzerforen – von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen - von Rechtschreib- und Grammatikfehlern nur so wimmeln.
Ein Vergleich mit anderen Berufen mag die Sachlage verdeutlichen: Würde man in irgendeinem Land der Welt jemanden zu einer berufsqualifizierenden Abschlussprüfung zulassen, wenn die betreffende Person keine fachlich fundierte Ausbildung z.B. als Krankenschwester, Chemiker oder Polizist, nachweisen kann? Mit Sicherheit nicht! Würde man solche Personen trotz fehlender Abschlussprüfung einstellen? Auch nicht, das leuchtet jedem ein. Nur beim Übersetzen halten sich viele grundsätzlich für berufsgeeignet. Man hat ja schließlich schon im Gymnasium Texte lateinischer und griechischer Schriftsteller übersetzt und auch schon an der Volkshochschule unterrichtet, wo liegt also da die Schwierigkeit?! „Das kann doch jeder Abiturient“!
Wenn aber schon bei fast jeder staatlichen Prüfung 50-60 % der Teilnehmer/-innen trotz einer mehrsemestrigen Fachausbildung (!) nicht bestehen, wie mögen dann die Prüfungsergebnisse erst bei den Quereinsteigern aussehen? Nach den Erfahrungen der PA sind es 80-100%!
Nur in Bayern liegen die Durchfallquoten niedriger, weil die dortigen Fachakademien in einem sechssemestrigen zweistufigen Fachstudium (Stufe 1: staatl. gepr. Fremdsprachenkorrespondent; Stufe 2: staatl. gepr. Übersetzer) vorbildlich und auf hohem Niveau ausbilden und im Gegensatz zu anderen Bundesländern höhere Anforderungen an die
Vorbildung stellen.
Übersetzen ist eine geistige Arbeit ersten Ranges mit hohen Anforderungen nicht nur in (fach-)sprachlicher und fachlicher Hinsicht, von der enormen Verantwortung auf Grund einer späteren Ermächtigung bzw. öffentlichen Bestellung und Beeidigung ganz zu schweigen! Wer die erforderlichen Grundlagen nicht beherrscht, wird in der Praxis früher oder später scheitern.
Ich habe bei der Akad 17 Jahre lang Einstufungsklausuren für die Übersetzerausbildung korrigiert (Hin- und Herübersetzungen mittleren Niveaus, jeweils 30 Zeilen, keine Fachtexte). Die Ergebnisse waren teilweise niederschmetternd. Selbst bei einschlägig ausgebildeten deutschen Uni-Absolvent/-innen mit allen möglichen Abschlussbe-zeichnungen (Dipl.-Sprachmittler etc.) waren die Leistungen im Deutschen und in der Fremdsprache teilweise so katastrophal, dass sich die Note 6,0 noch schmeichelhaft ausnahm. Den Vogel schoss ein Kandidat mit 72 Fehlern in 60 Zeilen ab. Manche konnten das gar nicht fassen (?) und protestierten gegen die Benotung, aber seltsamerweise (oder: bezeichnenderweise?) nahm keiner die angebotene Gelegenheit zur Einsicht in seine miserabel benotete Zulassungsarbeit wahr!
Da ist es nicht verwunderlich, wenn die PA bei der Zulassung und bei den Prüfungstexten im Interesse des Berufsstandes hohe Maßstäbe anlegen.
Die Notengebung bei den staatlichen Prüfungen wird übrigens den Veröffentlichungen in der Fachpresse zufolge im Vergleich zu den Handelskammern und den Hochschulen am strengsten gehandhabt. An den Hochschulen gelten Prüfungen noch bei 40 von 100 Punkten, bei den IHKn bei 50 Punkten als bestanden. Die in den Prüfungsordnungen der Hochschulen verankerten Bewertungsrichtlinien erinnern mehr an ein „Durchwinken“ der „Pisalinge“, während bei den staatlichen Prüfungen schon wenige markante Fehler das „Aus“ bedeuten. Nach meiner lang-jährigen Lehr- und Korrekturerfahrung im Hochschulbereich können mit 40 Punkten bewertete Leistungen jedoch beim besten Willen nicht mehr als „wirtschaftlich verwertbar“ bezeichnet werden.
Großen Respekt habe ich hingegen vor den KandidatInnen, die sich – insbesondere im Fernunterricht - unter erschwerten Rahmenbedingungen den harten Anforderungen der staatl. Ü-Prüfung stellen. Haltet durch und verfolgt euer Ziel trotz aller Widrigkeiten geduldig, aber hartnäckig!
Viele Grüße
Reinold Skrabal
Prüfungszulassung ohne Fachausbildung
- Reinold Skrabal
- Forums-Scout

- Beiträge: 298
- Registriert: 19.01.03 19:32
- Wohnort: Göppingen
- Kontaktdaten: